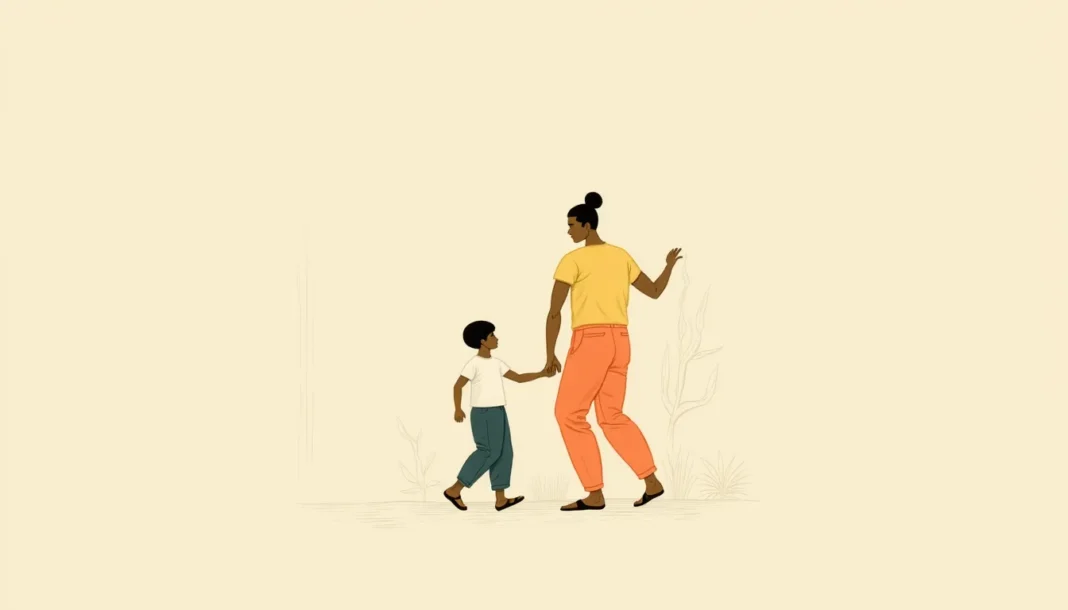Die Pubertät – eine Zeit des Umbruchs, der Suche nach Identität und der ersten großen Entscheidungen. Für Eltern kann es eine Achterbahnfahrt der Gefühle sein, besonders wenn Themen wie Drogenkonsum ins Spiel kommen. Was passiert, wenn der eigene Sohn kifft? Ein Vater berichtet von seinen Erfahrungen, Ängsten und dem schwierigen Weg, das Vertrauen nicht zu verlieren.
Der Schock der Entdeckung
Es beginnt oft mit einem unguten Gefühl, einer Veränderung im Verhalten des Kindes. Gregor Lindemann, unser Protagonist, bemerkte, dass sein 15-jähriger Sohn sich veränderte. Die Entdeckung, dass dieser Drogen nahm, stürzte ihn in eine tiefe Krise. „Ich habe mich in meinem Sohn getäuscht“, gesteht er sich ein. Ein Gedanke, der viele Eltern in dieser Situation quält. Hinzu kommt die Kluft zwischen den Generationen, die Unverständnis für die Lebensrealität der Jugendlichen mit sich bringt. „Als alter Erwachsener, wie mein Sohn mir vorhält, habe ich keinen Schimmer davon, was heutzutage bei den Jungen so abgeht.“ Der Vorwurf des Sohnes, es sei doch „nur Kiffen“, verstärkt die Hilflosigkeit des Vaters.
Die Normalisierung von Drogenkonsum unter Jugendlichen ist ein wachsendes Problem. Was früher als Tabuthema galt, wird heute oft verharmlost. „Jeder in seinem Alter kiffe“, argumentiert der Sohn, „und dass die Eltern seiner Freunde viel cooler damit seien als ich.“ Dieser Satz trifft viele Eltern ins Mark. Der Druck, „cool“ zu sein, um den Kontakt zum Kind nicht zu verlieren, steht im Widerspruch zur elterlichen Verantwortung, das Kind vor Gefahren zu schützen. Gregor Lindemann beschreibt diesen inneren Konflikt eindrücklich.
Vernunft gegen Gruppenzwang
Die Argumente des Vaters prallen an der Realität des Sohnes ab. Vergleiche mit dem Sprung von einer Brücke ziehen nicht, und der Hinweis auf Freunde, die ebenfalls kiffen und denen es scheinbar nicht geschadet hat, verunsichert zusätzlich. Die Hoffnung, dass es sich nur um eine Phase handelt, vermischt sich mit der Angst vor den langfristigen Folgen. Der Vater versucht, vernünftig zu argumentieren, erklärt die schädlichen Auswirkungen auf das Gehirn in der Entwicklung und bittet den Sohn, mit dem Kiffen noch ein paar Jahre zu warten. Doch die Kontrolle über das Verhalten des Sohnes entgleitet ihm zunehmend. Er weiß, dass er ihn nicht einsperren kann und hofft auf Vertrauen und Einsicht.
Die Situation eskaliert, als der Vater eine digitale Feinwaage und eine Wasserpfeife im Zimmer seines Sohnes findet. Der kleine Bruder berichtet von Kiffrunden mit Freunden, von roten Augen und einer beängstigenden Atmosphäre. Der Verdacht, dass der Sohn nicht nur konsumiert, sondern auch dealt, keimt auf. Das Misstrauen beginnt, sich wie ein dunkler Schatten über die Beziehung zu legen. Die Eltern stehen vor der Frage, wie viel Kontrolle sie ausüben dürfen, ohne das Vertrauen des Kindes zu verlieren.
Der Verlust des Vertrauens
Silvester wird zum Wendepunkt. Der Sohn verspricht, um zwei Uhr zu Hause zu sein, doch er kommt erst um vier. Die Ausrede, er habe mit Freunden im Park „gechillt“, entpuppt sich als Lüge. Ein zufällig mitgehörtes Telefonat enthüllt die Wahrheit: Er hat die Nacht mit seinem Dealer verbracht. Der Vater ist wütend, geschockt und voller Angst. „Du hast mich angelogen!“, schreit er seinen Sohn an. Er spürt, dass dieser tiefer in die Drogenszene verstrickt ist, als er zugeben will. Von diesem Moment an fällt es ihm schwer, seinem Sohn noch zu vertrauen. Jede Handlung, jede Begegnung wird von Misstrauen überschattet. Verkauft er alte Kleider, um Drogen zu finanzieren? Hat er seine Boombox versetzt? Jedes Treffen mit Freunden wird zum potenziellen Kiffgelage.
Die Situation spitzt sich zu, als der Vater droht, den Freunden des Sohnes Hausverbot zu erteilen und das Taschengeld zu streichen. Die Reaktion des Sohnes ist heftig: Er droht, den Kontakt abzubrechen und nie wieder etwas zu erzählen. Der Vater steht vor einem Dilemma. Er will seinen Sohn nicht verlieren, aber er will auch nicht tatenlos zusehen, wie er sich selbst zerstört. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren und den Sohn in die falschen Hände zu treiben, ist allgegenwärtig.
„Es ist gut, dass ich streng bin und eine klare Meinung zum Kiffen habe. Ob es auch gut ist, dass ich keine ernsthaften Konsequenzen gezogen habe, weiß ich nicht.“
Die Suche nach Hilfe
In seiner Verzweiflung sucht der Vater professionelle Hilfe. Eine Drogenberaterin beruhigt ihn zunächst und betont, wie wichtig es sei, den Kontakt zum Kind nicht zu verlieren. Sie warnt jedoch auch vor Eltern, die ihre eigene Kiffer-Vergangenheit verherrlichen oder den Drogenkonsum ihres Kindes bagatellisieren. „Ernsthaft Sorgen müssen Sie sich erst machen, wenn Ihr Sohn völlig antriebslos wird“, erklärt sie, „wenn er nur noch in seinem Zimmer hängt und auch nicht mehr zum Fußball geht.“
Ein Elternabend in der Schule bringt weitere Erkenntnisse. Der Sozialarbeiter einer Drogenberatung warnt davor, das Kiffen von heute mit dem von früher zu vergleichen. Die heutige Indoor-Züchtung von Cannabis habe einen viel höheren Wirkstoffgehalt und könne die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Viele Symptome, die der Vater an seinem Sohn beobachtet, könnten sowohl durch das Kiffen als auch durch die Pubertät verursacht sein. Die Unsicherheit bleibt bestehen. Die Herausforderung für Eltern besteht darin, die Anzeichen von Drogenkonsum richtig zu deuten und angemessen zu reagieren.

Ein Hoffnungsschimmer
Ein Streit führt zu einem überraschenden Moment der Ehrlichkeit. Der Sohn weint, weil er sich vom Vater nicht wertgeschätzt fühlt und das Gefühl hat, ständig nur schlechte Dinge zu tun. Dieser Ausbruch berührt den Vater tief. Er erkennt, dass er seinem Sohn öfter sagen sollte, wie stolz er auf ihn ist. Er erklärt ihm seine Angst, dass er sich hängen lasse und in eine Abwärtsspirale gerate. Der Sohn beteuert, dass er so nicht sei, und der Vater beschließt, ihm wieder mehr zu vertrauen. Er hofft, dass er es nicht irgendwann bereut. Die Statistik des Sozialarbeiters, dass 85 Prozent der Jugendlichen das Kiffen wieder in den Griff bekommen, gibt ihm Hoffnung.
Die Geschichte von Gregor Lindemann ist ein Spiegelbild der Herausforderungen, vor denen viele Eltern in der Pubertät ihrer Kinder stehen. Es geht um Vertrauen, Kontrolle, Ängste und die Suche nach dem richtigen Weg, das Kind zu unterstützen, ohne es zu verlieren. Es ist ein Balanceakt zwischen Strenge und Nachsicht, zwischen Loslassen und Festhalten. Die Pubertät ist eine Zeit des Wandels, nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern auch für ihre Eltern. Es ist eine Zeit, in der alte Gewissheiten in Frage gestellt werden und neue Wege gefunden werden müssen, um miteinander in Kontakt zu bleiben.
Fazit: Vertrauen und Unterstützung als Schlüssel
Die Geschichte von Gregor Lindemann zeigt, dass der Umgang mit Drogenkonsum in der Pubertät eine große Herausforderung für Eltern darstellt. Der Schlüssel liegt darin, den Kontakt zum Kind nicht zu verlieren, offen zu kommunizieren und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist wichtig, eine klare Haltung zum Drogenkonsum zu haben, aber auch die Ängste und Sorgen des Kindes ernst zu nehmen. Vertrauen und Unterstützung sind entscheidend, um dem Kind zu helfen, den richtigen Weg zu finden und die Pubertät erfolgreich zu meistern. Die Geschichte von Gregor Lindemann macht Mut, nicht aufzugeben und an die Stärke der eigenen Erziehung zu glauben.
Eltern.de